Heute steht im Spiegel Online ein Artikel
über ein interessantes Phänomen, zu dem ich selbst gerade ein wenig
forsche: Die Frage, wie sich Erinnerung und Fiktion so weit überlagern,
dass sie sich nicht mehr voneinander trennen lassen. Der Artikel
untersucht das Phänomen der „persönlichen Rückblende“ (sic!) anhand von Kriegserlebnissen:
Dass Erinnerungen eine diffizile Sache sein können, zeigte sich auch im
amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf von 1980. Kandidat Ronald
Reagan berichtete bei öffentlichen Veranstaltungen wiederholt und mit
Tränen in den Augen von seiner persönlichen Geschichte als
Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg: Sein Bomberpilot habe die
Besatzung zum Abspringen aufgefordert, nachdem die Maschine getroffen
worden war. Ein junger Schütze war aber so schwer verwundet worden,
dass er die Maschine nicht verlassen konnte. Da sagte der heldenhafte
Captain: „Macht nichts, Sohn. Dann bringen wir die Kiste eben gemeinsam
runter.“ Ich habe es doch selbst erlebt! Doch Reagan erinnerte sich hier
keineswegs an eigene Erlebnisse, sondern an eine Szene aus dem Film
„Wing and a Prayer“ von 1944. Dennoch war er völlig davon überzeugt, die Wahrheit zu sagen.
Ich stelle
mir die Frage, wie Ereignisse der Kriminalhistorie sich durch
psychologisch-narratologische Techniken so in der Erinnerung
einschreiben, dass sie „erzählbar“ werden, Kohärenz stiften, wo voher
Kontingenz herrschte und damit vielleicht erst die Grundlage für eine
fiktionale Adaption bilden.
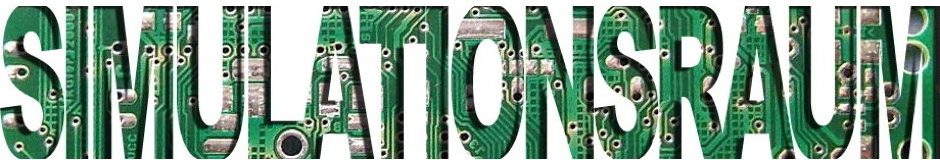




Die These, dass Erinnerungen zum einen als Spuren verdichtet sind, die zum anderen emotional aufgeladen und dadurch auf einer nicht-rationalen Ebene indexikalisiertt werden, ist recht plausiebel, erinnert mich aber Teilweise an die freudsche Gedächtniskonzeption. Weitaus interessanter ist aber der Zeitpunkt ab welchem der Autor ein identifizierendes Gedächtnis verortet: Ab dem 3. Lebensjahr.
Das trifft recht gut mit der Lacanschen Spiegelphase zusammen (ungefähr wenigstens). Ein weiteres Indiez, auf den zusammenhang von Spiegelphase und Gedächtnis ist die Aussage, dass „während die Geschichtsschreibung eine möglichst objektive Wahrheit sucht und dabei ausgefeilte Techniken der Quelleninterpretation entwickelt hat, bezieht sich Erinnerung immer auf die Identität desjenigen, der sich erinnert.“ Die Identität wird aber nach Lacan erst ab der Spiegelphase möglich. Es könnte sehr ergiebig sein den Zusammenhang dieser und dem (imaginerten) Gedächtnis zu untersuchen, oder gibt es von Lacan dazu eine Stellungnahme?
texturmutant