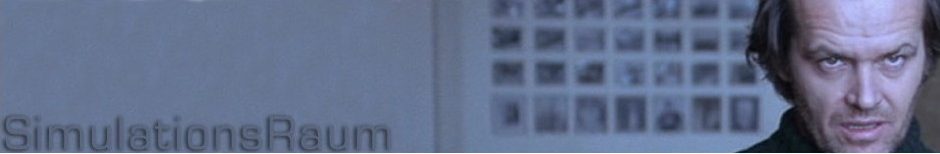I, Zombie – A chronicle of Pain (GB 1998, Andrew Parkinson)
Nachdem mich Parkinsons „Dead Creatures“
auf dem FFF 2003 ziemlich überwältigt hatte, habe ich mir sein
Vorgängerwerk im Frühjahr 2004 bestellt. Nach etwa 9 Monaten Wartezeit
ist er dann geliefert worden. Der an die unrühmlichen Publikationen
eines Verlages aus Hille gemahnende Untertitel („Cronicles of …“) hat
mich dann erst noch zögern lassen. Gestern habe ich mir den Film aber
dann doch mal angeschaut.
David, so heißt unser Zombie, findet bei einer Wanderung durch den Wald
(er sammelt Flechten für ein Forschungsprojekt) ein scheinbar
verlassenes Abbruchhaus. Darin liegt eine verstmmelte Leiche und ein
Raum weiter eine sich in Krämpfen windende Frau. Als David versucht sie
zu bergen, beißt sie ihn und überträgt damit das Zombie-Virus auf ihn.
Nach Tagen des besinnungslosen Herumirrens im Wald und nachdem David
einen Jogger angefallen und gefressen hat, kehrt er zurück in die
Stadt. Zu seiner Freundin kann und will er nicht zurück. So mietet er
sich eine kleine Wohnung, von wo aus er in unregelmäßigen Abständen
seine Beutezüge unternimmt. Er führt gewissenhaft Tagebuch über seinen
geistigen und körperlichen Verfall, beobachtet genau die
Hunger-Reaktionen und seine immer häufiger auftreteneden
Halluzinationen.
Ähnlich wie „Dead Creatures“ beschreibt „I, Zombie“ die persönlichen
Konsequenzen der Zombifizierung aus der Sicht des Infizierten. Er
stellt sich damit radikal gegen die Tradition, die die Untoten gern als
Abspaltung der Gesellschaft und damit als Bedrohung inszenieren (diese
Sichtweise hat „Dead Creatures“ durch seinen anachronistischen
„Zombiejäger“ schon gekonnt persifliert). Der
Untote in „I, Zombie“ ist die Hauptfigur. Seine Geschichte von der
Infektion über das langsame Siechtum bis zum Suzid wird in langsamen
Einstellungen berichtet. Dazwischengeschaltet sind die Reaktionen
seiner Freunde und Verwandten, die den jungen Mann vermissen und über
seine Persönlichkeit reflektieren. Sie denken, er sei schlicht
verschwunden und ahnen nicht, dass er sein sich immer mehr ins
schlichte Sein verwandelndes Dasein in derselben Stadt fristet.
„I, Zombie“ bleibt immer dicht an seinem Protagonisten. Wie in „Dead
Creatures“ wird Gewalt zwar gezeigt, doch so beiläufig und am Rande des
Bildes, dass der Effekt stets im Hintergrund bleibt und die
dargestellte Gewalt schlicht das nicht zu vermeidende Schicksal von
Davids Existenz darstellt. Häufig wird David vor dem Spiegel gezeigt,
der seinen Verfall ihm selbst dokumentiert. Die dabei auftretenden
Links-Rechts-Verwirrungen korrespondieren mit Andrews Gefühl eines sich
immer weiter vom Körper abtrennenden Bewusstseins. Fast schon einen
ironischen Kommentar vermutet man in solchen Szenen, wenn etwa der
Linkshänder David vor dem Spiegel sitzt und schreibt und sein
monströses Äußeres im Spiegel als „Rechtshänder“ dargestellt wird.
Diese „Normalisierung“ die der Film mit Bestialisierung gleichsetzt,
ließe sich natürlich als „sozialer Sarkasmus“ lesen. Hierfür spräche
das acuh Zombie-Motiv überhaupt.
Dennoch glaube ich nicht, dass man „I, Zombie“ aus der gleichen
Perspektive bewerten sollte, wie etwa die Filme Romeros. Parkinsons
stilles Werk ist eher dazu geeignet, die psychische Isolation des an
der Welt krankenden zu vermitteln. Seine Krankheit ist Ausdruck seiner
Isolation (und nicht umgekehrt) – ich formuliere das jetzt einfach mal
so apodiktisch. „I, Zombie“ ist ein existenzialistischer Film. Das „I“
im Titel scheint diese Sichtweise zu unterstützen.