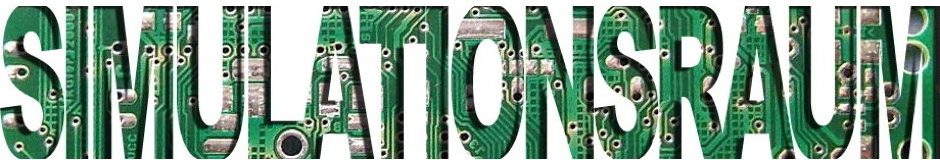Boo!
The Dark Hours
Dead Meat
Boo (USA 2004, Anthony C. Ferrante)
Boo! ist eine Frechheit sondergleichen. Viel hilft viel,
müssen sich die Macher gedacht haben, als es daran ging, den Film mit
Effekten auszustatten. Jedes, aber auch wirklich jedes
Horrorfilm-Klischee findet sich hier wieder. Die Vorhersehbarkeit, mit
der die Zutaten ins Bild rücken, ist dabei nicht einmal das
ärgerlichste. Es ist der ernsthafte Gestus, die Naivität, mit der uns
das alles vorgesetzt wird, als wäre es brandneu. Schon zu Beginn, als
eine recht plumpe Zitation des Prologs aus Scream präsentiert wird,
hält es der Film nicht für nötig, sich ironisch von seiner Quelle zu
distanzieren. Und so geht es dann auch weiter: Vom Haunted-House-Film
bis zum Scary-Child-Movie wird abstands- und sinnlos alles in Boo!
hinein verfrachtet, was nach Erfolg riecht. Herauskommen sollte dabei ein Gruselfilm nach Rezept, der auf jeden Fall funktioniert. Herausgekommen ist dabei eines der plumpesten und dümmsten Machwerke der Horrorfilmgeschichte.
The Dark Hours (Kanada 2004, Paul Fox)
Die Neudefinition des Thrillers als Genre der
psychologischen Introspektion ist im Fall von The Dark Hours ein
willkommener Anlass, das Innenleben der Protagonistin den Zuschauern
bildhaft vor Augen zu führen. Die Gewalt und Brutalität der Ereignisse,
die sich zum Ende hin vielleicht doch nur auf eine einzige Szene der
Selbstverstümmelung reduziert, affiziert den Zuschauer und lässt ihn
körperlich nachvollziehen, was sich in der Psyche der Hauptdarstellin
abspielt. Die Optik, vor allem die eindringlichen Nahaufnahmen der
Gesichter, die Abbildung der emotionalen Oberflächen unterstützten
dieses Prinzip. Im Falle des ganz ähnlichen Films High Tension hat es
man konnte das den Kritiken zum Film entnehmen etliche
Missverständnisse gegeben, die dem Drehbuch einen billigen und
unmotivierten Plot-Twist zur Auffrischung der hinlänglich bekannten
Serienmörder-Geschichte unterstellt haben. Bei The Dark Hours könnte
dies wieder passieren, wäre jedoch schwerer zu argumentieren. Denn hier
sind die sich entwickelnden Klischees ein starker Hinweis darauf, dass
etwas nicht stimmt mit der Erzählung, wie sich sich vor unseren Augen
entwickelt. Der Plottwist erscheint schon fast als notwendige Folge der
Geschehnisse, wenn man nicht von einem allzu starken Stilbruch zwischen
exzellenter Charakterisierung und plattitüdenhafter Narration ausgehen
will. So bleibt dem Betrachter schließlich die schwierige Aufgabe, die
Qualität der imaginierten Ereignisse der Protagonistin zu entschlüsseln
eine wesentlich lohnendere Aufgabe, als das Mitfiebern mit der
Thriller-Handlung.
Dead Meat (Irland 2004, Connor McMahen)
Vieles borgt sich Dead Meat aus der Geschichte des
Zombiefilms. Angefangen beim Setting, das in seiner Kargheit sehr an
Rollins Pesticide erinnert, über die politisch-kritische
Parabelhaftigkeit der Zombiekrankheit (hier: BSE), wie sie aus 28 Days
later bekannt ist, bis hin zu seinen fast schon expressionistischen
Bildern, die wie aus Night of the living Dead entnommen scheinen. Die
Variationsmöglichkeiten sind zugegebenermaßen nicht sehr groß nach dem
bereits hundertfach ausbuchstabierten Varianten des Zombiefilms. Doch
Regisseur und Drehbuchautor McMahen hat nur wenig Eigenes hinzuzufügen.
Zudem wirkt die Inszenierung die teilweise pixeligen Bilder der
Digitalkamera verstärken diesen Eindruck wie die eines jener
Amateurfilme, die ab den 1990er Jahren auf den Undergroundfilm-Markt
drängten. Insgesamt bleibt Dead Meat damit wohl ein Film unter vielen
solcher Art, bei dem allenfalls das für das Sub-Genre neue
Produktionsland und das Setting (eben jene grünen Hügel Irlands)
originell sind. Als kritischer Beitrag zum Thema BSE kommt er zudem
wohl auch mit ein wenig zu großer Verspätung.