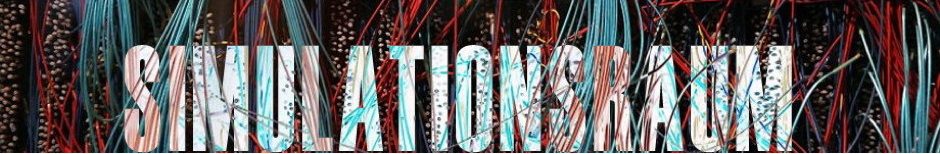Auf dem Sichtungsplan standen:
The Secret Adventures of Gustave Klopp
Freeze Frame
Casshern
Evilenko
The Secret Adventures of Gustave Klopp (Narco, F 2004, T. Aurouet & G. Lellouche)
… ist eine wirklich
erfrischende Komödie, die gleichzeitig ein Bild auf die französische
Unterschicht und die Pulp-Kulturproduktion allgemein wirft. Man muss
dem Film sehr zu Gute halten, dass er aus seinen Protagonisten eben
keine Karikaturen macht, sie nicht für billige Gags missbraucht,
sondern in ihren Emotionen und Träumen ernst nimmt. So ist etwa
Lenny, der beste Freund des narkoleptischen Helden Gustave, ein leidenschaftlicher
Jean-Claude-van-Damme-Fan und vom Wunsch beseelt, dem französichen
Karate endlich zu Weltklasse zu verhelfen. Seine Bemühungen sind
verzweifelt und urkomisch gleichermaßen und wenn er allein in seinem
Trailer sitzt und mit dem imaginierten van Damme Zwiesprache hält (der
sich für das Casting zu Narco gern zur Verfügung gestellt hat!), dann
bekommen die eigentlich absurden Szenen regelrecht moralische Tiefe.
Freeze Frame (UK/Irland 2004, John Simpson)
Trotz des fast schon Zuviel an Erzählung, sind es
vor allem die Bilder und die Vorstellung der notwendigen
Selbstentlastung des Verdächtigten durch Video-Totalüberwachung, die „Freeze
Frame“ bestimmen. Die Vorstellung, das eigene Leben bis ins privateste
Detail zum Gegenstand eines Videoarchivs zu machen, welches jederzeit
veröffentlicht werden können muss, um einen Verdacht von sich zu
lenken, ist eine erschreckend Utopie. Die Evidenz, die die
selbstgefilmten Bilder in Freeze Frame bekommen die Polizei erkennt
sie als zweifelsfreie Belege für Schuld und Unschuld an verdoppeln
sich in der Rezeptionssituation des Films. Auch wir wollen glauben was
wir sehen und zweifeln an dem, was sich in den Aufzeichnungslücken
zugetragen und uns später „nur“ mündlich überliefert wird. So müssen
wir am Ende schließlich erkennen, dass wir die Praxis der
Totalüberwachung zwar entsetzlich finden, ihr im Zweifelsfall jedoch
zustimmen, um die lückenlose Wahrheit zu erfahren. „Sehen“ und „Wissen“
sind dann entgültig gleichrangig.
Casshern (Jp 2004, Kazuyki Kiriya)
Völlig distanzlos verwurstet Casshern alles, was er
für zitabel hält, zu einer großen Erzählung von Krieg und Frieden,
nervt mit seinem Kitsch, überreizt mit seiner Opulenz, seiner nicht enden
wollenden Erzählung und seinem aufgesetzten Pathos. Was
fälschlicherweise als postmodern apostrophiert werden könnte, ist in
Wirklichkeit genau das Gegenteil: völlige Beliebigkeit zum Zweck der
ästhetischen Anästhetisierung! Fast bekommt man den Eindruck, der Film
wolle die Intelligenz seiner Zuschauer mit Bildern betäuben um seine
zweifelhafte Botschaft zu verkaufen. Doch dem filmhistorisch geschulten
Beobachter gehen die Beliebigkeiten dann jedoch zu sehr auf den Geist
und offenbaren sich die Sturkturen nur zu deutlich: Casshern das
ist Pop-Faschismus in Reinkultur, der sich durch Zitate und
Intertextualitäten weltoffen gibt, damit jedoch allein seinen
kulturellen Kannibalismus und seine Ohne-Wenn-und-Aber
Riefenstahl-Erhabenheitsäshetik zu Geld machen will.
Evilenko (GB/Italien 2004, David Grieco)
Evilenko ist ein Film, der sich in die
Tradition des authentischen Serienmörderfilms stellt. Viele seiner
Erzählmomente kommen dem Zuschauer aus Genreklassikern wie Es geschah
am hellichten Tag oder Nachts, wenn der Teufel kam bekannt vor.
Damit rekurriert der Film auch an das Vorwissen seines Publikums, das
ein fiktionales Produkt als um so authentischer einstuft, je mehr es seinen
ontologischen Status durch Zitation zu erhöhen vermag. Das intensive
Schauspiel Malcolm McDowells in der Rolle des Serienmörders forciert
die Präzision, mit der der Tätercharakter gezeichnet worden ist, noch
zusätzlich. Und dennoch bleibt der Film eigenartig blass und
unausgereift. Bei einer derartig intensiven historischen Verortung des
Stoffes und der Ausformulierung der politischen Parabel (mehrfach wird
die Peristroika für die Schizophrenie des Täters ja eines ganzen
Volkes verantworlich gemacht), ist die Recherche die sowjetischen Zu-
und Umstände Mitte bis Ende der 1980er Jahre betreffend, doch zu
dürftig ausgefallen. Alles an Evilenko wirkt wie der externe Blick auf
einen Kommunismus, der einem stets als Schreckgespenst vorgeführt
wurde. So hinterlässt der Film gemischte Gefühle. Er schafft es nicht,
sein Projekt die Metaphorisierung des Serienmordes als politsches
Phänomen ins Bild zu übersetzen, sondern zerfällt in seine
Bestandteile, die für sich betrachtet gekünstelt und gleichzeitig
unästhetisch wirken.