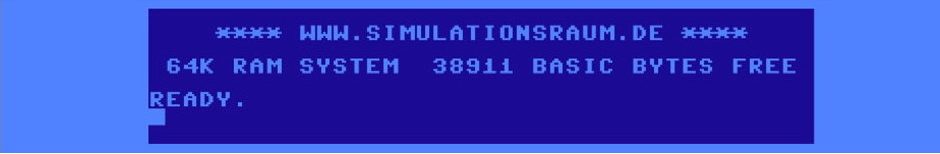L.A. Crash (Crash, USA 2004, Paul Haggis) (Cinedom Köln)
Ich hatte den ja schon auf dem Münchner Filmfest gesehen und für
absolut großartig befunden. Die zweite Sichtung hat mich noch in meinem
Urteil bestätigt.
Zu Beginn gibt Graham (Don Cheadle) das Thema des Films vor: „It’s the
sense of touch. In any real city, you walk, you know? You brush
past people, people bump into you. In LA, nobody touches you. We’re
always behind this metal and glass. I think we miss that touch so much,
that we crash into each other, just so we can feel something.“ Um
Berührugen geht es in jeder Hinsicht, seien sie nun physisch oder
emotional. Jeder Versuch, Nähe herzustellen oder zu vermeiden wird
durch Zufälle, Unfälle, Antipathien oder Sympathien konterkariert. Das
Motiv des Rassismus in Los Angeles ist dabei nur der Aufhänger, das
„ideologische“ Gerüst, welches das Thema von Nähe/Ferne auf ein
plastisches Niveau bringt. Den Film als einen Beitrag über den
Alltagsrassismus zu verstehen, käme deshalb meines Erachtens einer
unzulässigen Reduktion gleich – so gesehen kann „Crash“ nur verlieren,
weil die Plattitüden, die er abbildet einfach zu
melodramatisch/kitschig sind.
Dass es mehr mit dem Film auf sich hat, als ein solches
Hollywood-Lehrstück zu sein, verdeutlicht aber nicht nur die narrative
Feinstruktur, sondern vor allem auch die technische Umsetzung – hier
besonders die Montage. Da werden entfernte Punkte (andere Geschichten
oder andere Orte) häufig dadurch aneinander „nahe gebracht“, dass sie
die selben Passagen darstellen (Türen, Durchgänge, aber auch bestimmte
„übergreifende Themen“, wie Geld, Verkehr, …). Auf diese Weise wird
auch auf der Bildebene ständig Berührung und Nähe etabliert und damit
die gezwungen wirkenden Distanzierungsversuche (im Rassismus der
Protagonisten) kontrastiert.
Und ganz nebenbei entwickelt „Crash“ daraus eine eindringliche
humanistische Botschaft, die auf den Menschen als „animal sociale“
verweist – ihn in eine Art „Schicksalsgemeinschaft“ einbindet, durch
welche er erst als Mensch bestimmt wird. Die ständigen Versuche, sich
gegen andere Menschen oder Ethnien abzugrenzen, werden einfach dadurch
unterlaufen, dass das Leben in einer Stadt zwangsläufig Gemeinschaft
produziert – und zwar selbst in der Ablehnung des Anderen (weil das
Ablehnen als Valenz ja den Abgelehnten benötigt). Ein schlagendes
Beispiel dafür ist die Episode, in der der Polizist die Frau aus dem
brennenden Auto rettet, die er Tags zuvor noch misshandelt hat oder die
Uminterpretation des persischen Ladenbesitzers, der glaub, dass das
kleine Mädchen, dass er nicht erschossen hat, sein Schutzengel sei.
Für mich ist „Crash“ der bislang beste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe.