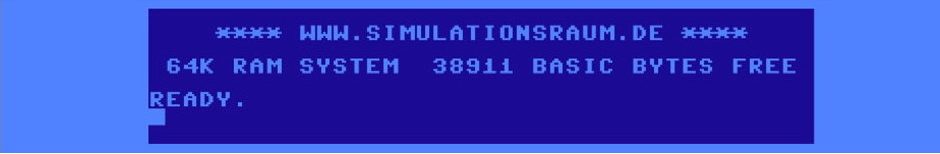Code: Unbekannt (D/F/Rumänien 2000, Michael Haneke) (DVD)
Wie angekündigt habe ich mir gestern Hanekes „Code: Unbekannt“ angesehen.
Interessant war vor allem, wie sehr sich der Vorgängerfilm („Funny
Games“) darin wieder findet. Die moralische und teilweise
moralisierende Erzählung kreist um das Phänomen der Anteilnahme: In
„Code: Unbekannt“ sind die Personen damit beschäftigt, anderen aus dem
Weg zu gehen, sich nicht in fremde Probleme einzumischen und nur an
sich selbst zu denken. Bricht jemand aus diesem Schema aus, so wird
sein Verhalten durch alle Instanzen direkt abgestraft. Sehr sinnfällig
ist dies bei dem schwarzen jungen Mann, der die Demütigung einer
Bettlerin durch einen Teenager nicht einfach hinnehmen will und diesen
mit Gewalt dazu auffordert, sich bei der Frau zu entschuldigen.
Resultat: Der Schwarze wird von der Polizei verhaftet, die Bettlerin
als illegale Einwanderin erkannt und des Landes verwiesen … und der
Teenager kommt ungestraft davon. Zivilcourage bringt nur Ärger.
Haneke verwebt ein halbes Dutzend Erzählstränge miteinander, indem er
sie ausschnittweise vorstellt und stets an Punkten abbrechen lässt, in
denen sich emotionale „Peaks“ andeuten. Gleich einem „Umschalten“
katapultiert er seinen Zuschauer dann zum nächsten Erzählfragment, das
wiederum in seinem intensivstem Moment abgebrochen wird usw. Das
Problem der „Anteilnahme“ verdoppelt der Film so in seinem
Montagerhythmus: Bevor wir zu sehr von einer Szene affektiert werden,
schaltet der Haneke weiter. Wenn die Erzählung irgendwann an den Punkt
zurückkehrt, an sem sich eine Katastrophe andeutete (etwa als Anne den
Zettel des kleinen Nachbar-Mädchens vor ihrer Wohnungstür findet, in
dem sie gebeten wird, dieses vor der andauernden Misshandlung durch
ihre Eltern zu schützen), ist diese meist schon vorüber (im Beispiel:
Anne ist „plötzlich“ auf der Beerdigung des kleinen Mädchens). Der Film
hat uns auf die sich anbahnende Katastrophe hingewiesen und führt uns
die Konsequenzen der Teilnahmslosigkeit vor Augen.
Und genau darin liegt die Crux: Abermals möchte Haneke seinen
Zuschauern einen Spiegel vorhalten, der ihnen ihre „emotionale
Vergletscherung“ (Haneke) vor Augen führt. Die Schlusssequenzen
nämlich, in denen uns der Film schon darauf konditioniert hat, dass wir
bei unangenehmen Dingen nicht dabei sein müssen, pervertieren dieses
Prinzip: Mehrere Episoden buchstabieren Situationen aus, in denen
die vormals allein auf sich konzentrierten Figuren in Situationen
geraten, wo Einmischung (Zivilcourage, …) ihnen vor Augen führt, dass
sie auf die Gemeinschaft angewiesen sind.
Hier offenbart sich nun ein Lehrstück, das dem konservativen Duktus von
„Funny Games“ in nichts nachsteht. Denn anstatt es bei einer rein durch
den Plot motivierten moralischen Erzählung zu belassen, überformt
Haneke seinen Film auf allen Ebenen um seine Aussage zu unterstreichen.
Das wirkt auf den ersten Blick sehr stimmig, bekommt aber, wenn man
sich der politischen Implikation bewusst wird, den Beigeschmack von
Bigotterie.
Denn es ist ja der Erzähler selbst, der sich durch seine Bildästhetik
von den Situationen abwendet und „wegzappt“ (mit diesem Montageprinzip
hat Haneke wieder einmal den Hauptschuldigen für unser „Weggucken“
benannt: das Fernsehen). Mit der Ankündigung, dass wir es eine
„unvollständige Erzählung“ zu sehen bekommen, redet er sich
narratologisch heraus. Es ist jedoch zu keiner Zeit so, als wolle man
sich dieser Haltung fügen: Ich zumindest hätte die Situationen ganz
miterleben wollen. Wie in „Funny Games“ treibt Haneke sein Spiel mit
dem Zuschauer, indem er ihm etwas (nicht) zeigt und ihm hinterher
vorwirft er hätte es doch gern (nicht) gesehen. Auf solche moralischen
Fußangeln kann ich gern verzichten.