Ich weiß: Man soll den Tag nicht vorm Abendprogramm loben, aber weil ich angesichts der Kannibalismus-Neuerscheinung ja ein wenig vorsichtige Skepsis geäußert hatte, will ich hier einen diese abschwächenden Zwischenbericht über Christian Mosers Buch geben.
Ich habe gerade die ersten beiden Kapitel von „Kannibalische Kaharsis“
gelesen (also 55 Seiten – etwa die Hälfte des Buchs) und bin sehr
angetan von Mosers Vorgehen. Im ersten Kapitel stellt er historische
und literarische Texte über den Kannibalsimus einander gegenüber und
leitet daraus das Begriffsdoppel „Anthropophagie“ und „Anthropemie“ ab.
Diese Termini setzt er als Metaphern für die Beschreibung von Kulturen
ein: Solche Kulturen, die das Andere verinnerlichen (aggressiv oder
freundlich) nennt er „anthropophage Kulturen“, solche, die es absondern
und ausstoßen „anthropemische“. Worauf Moser hinaus will, wird schnell
klar: Die westliche Kultur mag den Kannibalismus als ethnologisches
Phänomen noch so sehr ablehnen (eine Ablehnung, die bis hin zur
Verleugnung reicht!), sie selbst verhält sich jedoch beständig
anthropophagisch, indem sie das Andere inkorporiert.
Am Ende des ersten Kapitels widmet sich Moser einem Streit, der Ende
der 1970er Jahren unter den Ethnologen ausgebrochen ist: Der Ethnologe
William Arens leugnet in seinem Buch „The Man-Eating Myth“
die Existenz des Kannibalismus vollständig und verweist alle Berichte
darüber in die Sphäre des Mythischen. Texte über Kannibalsimus
entbehren das Empirische und überformen ihren Gegenstand zur
Horror-Erzählung (hier referiert Moser den Arens-Vergleich zwischen
Freuds „Totem und Tabu“ und Romeros „Night of the living Dead“).
Demgegenüber positioniert sich Marshall Sahlins, welcher Arens
unterstellt, dessen Ablehnung sei ebenfalls mythenhaft. Moser verweist
– mit Blick auf die methodologische Unschärfe (beden Untersuchungen
fehlt der Blick auf den „linguistic turn“) beide Texte in die selbe
Liga: Sie versuchen die Ethnologie vor der Gefräßigkeit der
Kulturindustrie und deren Hunger nach Sensationen zu retten.
Das zweite Kapitel behandelt die historischen Reiseberichte James
Cooks, der ein „kannibalistisches Experiment“ vor Neuseeland angestellt
hat. Als ihm zugetragen wurde, dass die Maori Teile eines Menschen
gegessen hatten und dessen Kopf von den Mitarbeitern Cooks „ertauscht“
wurde, lies er ein paar der Neuseeländer vor seinen Augen Stücke dieses
Kopfes essen. Seine eigene ablehnende Haltung dem Kannibalsimus
gegenüber stellte er zugunsten des „Tatsachenbeweises“, den er nun
liefern konnte, zurück. Ein „gefundenes Fressen“ für Moser: Hier
offenbart sich der anthropophage Charakter der westlichen Kultur
ihmzufolge am deutlichsten: Cook lehnt jeden hermeneutischen Zugang zur
Kultur der Maori ab, indem er die kannibalistische Praxis aus ihren
Kontext reißt und nur „als solche“ betrachtet.
„Nicht der Mund der Neuseeländer, sondern das Auge des
Entdeckers ist hier das eigentliche Organ kannibalischer Ingestion.
[…] Das kannibalische Verhalten, das Cook den Neuseeländern
unterstellt, wird von ihm selbst praktiziert. Er ist es, der dem
Anwesenden gegenüber dem Abwesenden einen unbedingten Vorrang einräumt;
er ist es, der einen direkten Zugang zur Kultur der Neuseeländer zu
erlangen sucht, indem er die Mittlerdienste der Sprache verschmäht und
sich ganz auf die wahrheitserschließende Kraft des Auges verläßt.“ (44)
Nach solchen wie ich finde großartigen dialektischen Wendungen des
Kannibalismus-Topos bin ich schon sehr gespannt, wie es weiter geht!
Ich werde dann berichten.
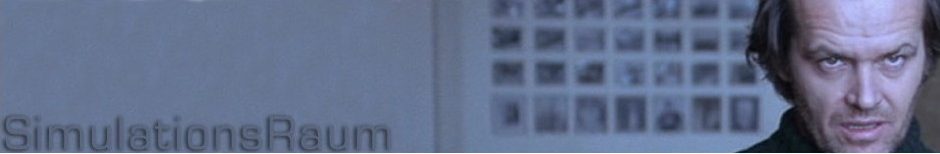




Wirklich interessante Überlegungen! Ist aber nicht jede Kultur eigentlich eine Mischung aus dem „anthropophagen“ und „anthropemischen“ Typus? Es kommt nur auf den Standpunkt an: Einige Sachen werden verinnerlicht, die anderen – ausgestoßen. Deshalb würde mich interessieren, welche Kulturen seiner Meinung nach überwiegend anthropemisch sind und woran er das festmacht?
Moser sagt das auch, dass Kulturen immer ein Mischverhältnis aus beidem sind. Es geht aber mehr darum, welche Struktur überwiegt.
Ja, aber wie will er das genau untersuchen und beweisen? Das muss wohl als Hypothese stehen bleiben. Und dass die westliche Kultur mehr verinnerlicht als die anderen, wage ich persönlich zu bezweifeln…
Er untersucht nicht die „Kulturen im Ganzen“ (das wäre auf den paar Seite auch ziemlich vermessen), sondern im Moment ihrer Begegnung – welche der beiden Formen im Zusammentreffen dominiert.
Ich glaube, da habe ich ihn wohl missverständlich wiedergegeben. Es ist ja keineswegs so, dass er das empirisch nachweisen will, sondern er versucht die verabsolutierenden Interpretationen vom Selbst und vom Andren, die sich als Reinformen des anthtropophagen und anthropemischen voneinander abgrenzen, zu kritisieren.
Ich habe das Buch zwar noch nicht zu Ende gelesen (weil ich den ganzen Tag unterwegs war), glaube aber auch nicht, dass es eine Art „Abrechnung mit der Eigenkultur“ ist. Vielmehr scheint es auch darum zu gehen, scheinbar objektivistische Ansätze (wie etwa des Postkolonialismus) ein wenig ins Wanken zu bringen, indem deren Diskurs als genauso mit beiden Facetten behaftet dargestellt wird, wie die anderen.
Ich will mich jetzt aber, bevor ich das Buch zu Ende gelesen habe, nicht weiter aus dem Fenster hängen. Nur soviel, dass ich den Ansatz sehr schlüssig und sehr spannend finde.
Dann bin ich auf deinen „abschließenden Bericht“ gespannt. 🙂