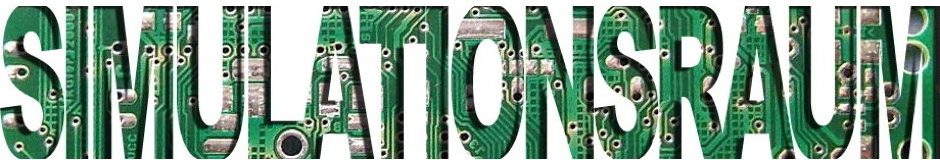Kolloquium „Walter Benjamin“
Je mehr ich von dem Text verstehe, desto weniger verstehe ich ihn.
Benjamins Stil stemmt sich dem Verständnis geradezu entgegen. Habermas‘
Vorwurf an Derrida, er sei „rhetorisch“ lässt sich – das wurde im
Kolloquium diskutiert – stellenweise auf Benjamins „Vorrede“ übertragen
(was ich angesichts solcher Sätze nachvollziehen kann: „Wie bei der
Stückelung in kapriziöse Teilchen die Majestät den Mosaiken bleibt, so
bangt auch philosophische Betrachtung nicht um Schwung.“) Neben derlei
Erörterungen gibt es dann noch ein paar Ausflüge zu Nietzsche (den
Prof. wetzel als Vordenker Benjamins belegt) und in den in der
„Vorrede“ angesprochenen Platon-Dialog „Symposion“, aus dem dann das
erotisch-ästhetische Stufenmodell vorgestellt wird.
Nächste Woche findet die letzte Veranstaltung zur „Vorrede“ statt.
Vorlesung „Kulturphilosophie“
Heute ging’s um „Förderkultur“. Angesichts der
Tatsache,
dass „niederkulturelle“ Artefakte wie der „Ternimator“-Film oder
„Wetten Dass …“ gefördert werden, „hochkulturelle“ Produkte von Luigi
Nono oder Lachemanns Oper „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ aber
„leer“ ausgehen, schlägt Prof. Seubold vor, Kulturförderung ganz zu
streichen und die Gesetze des freien Marktes walten zu lassen.
Mir missfällt dabei nicht nur die nicht näher begründete Unterscheidung
in „Hoch-“ und „Niederkultur“ (auf Nachfrage wurde mir erklärt: Er habe
ästhetische Argumente, die sei aber keine Ästhetik-Vorlesung), sondern
auch der kulturpessimistische Unterton – nach wie vor. Es scheint so,
als wähle der Referent für seine Thesen ausschließlich
„Negativbeispiele“ als Argument … die eben durch die selbe Anzahl + x
„Positivargumente“ widerlegbar sind. Beifall findet der Referent
größtenteils bei den „älteren Semestern“, die die plakativsten Thesen
(„Um sich Harald Schmidt leisten zu können, trennt sich die ARD von den
Radiosymphonieorchestern.“) mit ihrem eigenen „Jaja, früher war alles
besser.“ unterstreichen. Zum Schluss kommt aus dem Publikum noch ein
sehr griffiges Gegenargument gegen den Unsinn der Förderkultur, das
sich auf kulturhistorische Fälle von „hoher Förderungswürdigkeit“
bezieht. In der kommenden Woche geht es um „Sexualkultur“ (Prof.
Seubold hat bei der Einführung bereits auf den Gegenstand „Theresa
Orlowski“ verwiesen.)