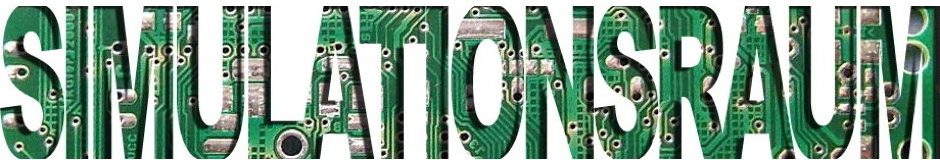17.03.04: I spit on your grave / Day of the Woman (DVD)
Bei
Filmen, die besonders „einfach“ daherkommen, sollte man immer auf der
Hut sein. Die einfache Struktur von „I spit“ lädt entweder dazu ein,
den Film „sinnlos“ zu finden oder ihn als eine Art „Parabel“ zu lesen:
Carol Clover hat zweiteres bereits in einem älteren Aufsatz in der
Sight & Sound getan und den „sportlichen Moment“ des Gangrape als
Strukturmoment kinematographischer De-Moralisierung von Sexualität und
Installation des „starken Frauentyps“ interpretiert.
Im „Rape
& Revenge“-Genre (ob es ein solches überhaupt geben kann, ist
fraglich) ist „I spit“ nahezu stilbildend, denn der Film entfaltet sein
Sujet nicht nur sehr „reißbrettartig“, sondern „diskutiert“ darin auch
die ihm immanenten Prinzipien. Beispiel: Der Aufbau – und das soll
keineswegs zynisch gemeint sein – ist in seiner Proportion und seiner
Themenentfaltung der eines Geschlechtsaktes: In den ersten 20 Minuten
das Vorspiel, in den folgenden 30 Minuten der (Haupt)Akt, danach etwa
20 Minuten Refraktärphase und dann die letzten 20 Minuten das
Nachspiel, in dem sich Intensität, Dauer der einzelnen Teilakte und
Rhythmus des Hauptaktes wiederholen.
Das ganze wir so klassisch
eingeleitet, wie es nur geht (bzw. wie man es erwartet): Jeniffer
präsentiert sich ihren späteren Peinigern als aufreizende
Großstädterin, diese – in Denken und Sprache vollständig sexualisiert –
nehmen das zum Anlass, sich ihr immer agressiver zu nähern. Es folgen
die Vergewaltigungen und danach die Rache, der Frau, der sich jeder der
Vergewaltiger zu entziehen versucht, in dem er a) der Frau und ihrer
„aufreizneden Art“ die Schuld gibt und B) auf die Gruppendymanik
verweist. (Clover) Doch das Gesetz des Spielfilms ist das jus talionis
… und das verlangt nach „Katharsis“. Und deshalb gibt es für die
rächende Frau keine Möglichkeit, ihre Rache zu unterbrechen, solange
bis die Opfer-Bilanz wieder stimmt. Aufdringliche Metaphern von
Reinwaschung, Versenkung und als phallisch konnotierte Fahrzeuge und
Waffen geben sich die motivische Klinke in die Hand.
Der extrem
durchdacht rhythmisierte Aufbau der Handlung verfolgt dabei vor allem
den Zweck, den Zuschauer in die Geheimnisse des filmischen jus talionis
einzuweihen und ihn für dieses Gesetz fügig zu machen. Dafür erhält er
bei „I spit“ abwechselnd die Perspektiven des unbeteiligten
Beobachters, die Täter- und die Opfer-Subjektive und wird damit in den
Regelkreislauf von Vergewaltigung und Vergeltung hineingezogen (jedoch
nicht im Sinne eines Haneke’schen „Mitschuldigen“). Die Wirkung scheint
mir dabei eine zweifache: Einerseits soll die Dramaturgie Mitleid und
Verständnis für die Frau und Hass und Rachegelüste für die Täter
stiften, andererseits – und hier liegt meines Erachtens der Clue des
Films – wirkt die extrem genau strukturierte Dramaturgie auf den
Zuschauer selbst wie ein Rape & Revenge-Erlebnis.
Man muss
nicht so weit gehen, wie Michale Haneke, der in jeder
kinematographischen Präsentation die Vergewaltigung des Zuschauers
sieht; aber gerade der Genrefilm zehrt sehr von den Erwartungen seiner
Zuschauer und schöpft seine Originalität aus der Andeutung und
Vortäuschung, diese Erwartungen würden dieses Mal nicht erfüllt – nur
um dann doch die Katharsis herbeizuführen im „Alles wird gut“-Ende.
Doch kann ein Rape & Revenge-Film überhaupt ein Genrefilm sein?
Desavouiert die in der außerfilmischen Wirklichkeit als unmoralisch
geltende Auge-um-Auge-Regel nicht die Katharsis, nach der am Ende die
Rechnung zwischen Opfer und Täter(n) beglichen ist? Und überhaupt: Was
ist denn die angemessene „Strafe“ für eine Vergewaltigung? Wirklich der
Tod? Und hat das Vergewaltigungsopfer, das rein hypothetisch ja „nach
dem Film“ der Justiz entgegen treten muss, überhaupt eine Perspektive
der „Wiedergutmachung“ zu erwarten?
Ich kenne keinen Rape
& Revenge-Film, der diese Fragen nicht zumindest subtil
mitinszeniert. Die meisten Vorwürfe, die diesen Filmen entgegen
gebracht werden, sind die, dass solche „Tötungsszenen […] in einer
diese Gewalttätigkeiten verherrlichenden Art und Weise [präsentiert
werden], indem das Verhalten der jungen Frau als die wahre Form zur
Lösung von Konflikten dargestellt wird.“* Doch am Ende von „I spit“
(und allen anderen Rape & Revenge-Filmen) steht gar nicht die
Genugtuung, sondern immer der schale Geschmack, dass die Summe des
Leides eigentlich nur vergrößert worden ist.
Anders ist das Ende
von „I spit“, in dem Jennifer ziellos mit dem Boot auf dem Fluß
umherfährt, wohl nicht zu deuten. Mehr dazu in Bremen.
maX
* Auszug aus dem Beschlagnahmebeschluss zu „I spit“