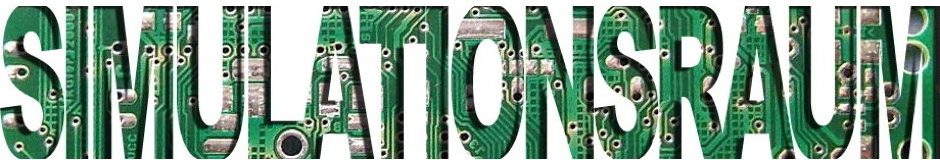Kaum ein Thema hat die kulturelle Entwicklung seit dem zweiten Weltkrieg derartig beeinflusst wie die Atombombe, der dritte Weltkrieg und die Zeit danach. Nachdem die Gefahr gebannt zu sein scheint, lohnt ein Rückblick auf 60 Jahre Atomkrieg im Film.
Als am 6. August 1945 die erste Atombombe in Hiroshima zum Einsatz kam und damit den zweiten Weltkrieg faktisch beendete, trat die Welt in ein neues Zeitalter, das Atom-Zeitalter ein. Die Entdeckung und Nutzung der Kernenergie zu kriegerischen und friedlichen Zwecken bewegte die durch sie beeinflussten Kulturen so nachhaltig, dass der Niederschlag, den dies in der Kunstproduktion fand, stilistisch und thematisch bestimmend für die gesamte zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde. Auch und vor allem der Film hat seismisch auf dieses Phänomen reagiert und ab Anfang der 1950er Jahre beinahe so etwas wie ein eigenes Genre entwickelt.
Dabei ist Radioaktivität als physikalisches Phänomen auf den ersten Blick überaus „unfilmisch“: Die Strahlen, die, je nach Art und Dosis Menschen und Tiere innerhalb weniger Tage erkranken und sterben lassen, sind unsichtbar. Das Sichtbare ist jedoch das Charakteristikum des Films, weswegen Filme, die sich mit dem Atomkrieg und seinen Folgen beschäftigen, entweder gezwungen sind, eine metaphorische Bildsprache zu entwickeln oder die unsichtbare Gefahr selbst zu Thema zu erheben. Eine bildhafte Entsprechung der Gefahr ist die auf zahlreichen Filmplakaten ikonisch gewordene Darstellung des Atompilzes, jener typisch geformten Rauchwolke, die durch den enormen Druck und die Hitze der atomaren Kettenreaktion entsteht. Darüber hinaus besitzt die explosionsartige Kernspaltung jedoch etwas Filmisches auf der rein physikalischen Ebene: Atombombenexplosionen werden zuerst sichtbar durch einen Blitz, der, wie sich Zeitzeugenberichten entnehmen lässt, in Hiroshima und Nagasaki dazu geführt hat, dass sich die Schatten der angeblitzten Gegenstände selbst auf optisch unempfindlichen Material wie auf Fotografien einbrennen. Zudem lässt sich Radioaktivität sichtbar machen, wenn sie auf unentwickeltes Filmmaterial fällt, das dann schwarz gefärbt wird. Der Atompilz, der Blitz und die Belichtung des Filmmaterials, sind in Filmen über den Atomkrieg zu visuellen Zeichen für den Beginn des Weltuntergangs geworden.
Die Frage nach der Schuld
Die erste kulturell einflussreiche Spur hat der Atomkrieg 1959 in Alain Resnais „Hiroshima mon amour“ hinterlassen, der jedoch vollständig ohne die erwähnten optischen Ingredienzien auskommt: Eine Französin und ein Japaner verbringen in Hiroshima eine Nacht miteinander und erinnern sich an den schicksalhaften Tag im Jahre 1945. Unsichtbar blieb der Krieg auch in Stanley Kramers im selben Jahr veröffentlichter Dystopie „On the Beach“, in der sich die letzten Menschen in Australien zusammenfinden, während sich ihnen die radioaktive Wolke (also Folge eines Atomkriegs) nähert. Kramer beschreibt in ambivalentem Tonfall, wie sich die Einzelschicksale seiner Protagonisten angesichts des nahenden Todes entwickeln, ist jedoch nicht in der Lage Hoffnung zu spenden. Ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre, als die direkte Gefahr eines atomaren Konfliktes noch unrealistisch schien, haben Filme wie „Hiroshima mon amour“ und „On the Beach“ Gedankenexperimenten gleich das kulturelle Trauma von Hiroshima und die Frage einer durch technisches oder menschliches Versagen herbeigeführten Katastrophe erörtert.
Als sich Anfang der 1960er Jahre durch den Kuba-Konflikt die politische Lage zwischen den West- und Ostmächten zuspitzt, reagiert der Film ganz anders darauf. 1964 spielt Sidney Lumet in „Failsafe“ noch einmal mit dem Gedanken, was geschähe, wenn durch ein technisches Versagen Atombomben nach Moskau geschickt würden. Aber schon im selben Jahr zeichnet Stanley Kubrick den Wahnsinn, der sich hinter dem „Megadeath“ eines atomaren Konfliktes verbirgt, in seiner bitteren Komödie „Dr. Strangelove“ nach. Dem Wahnsinn der Militärs, die einen Atomkonflikt, der keine Gewinner kennen kann, dennoch für sich entscheiden wollen, aspektiert John Frankenheimer im selben Jahr in „Seven Days in May“, der die Verschwörung einiger Generäle gegen den US-Präsidenten beschreibt, als dieser in atomare Abrüstungsverhandlungen treten will. Die Anspielung auf John F. Kennedy, der die Kubakrise heraufbeschworen hatte und in einer außergewöhnlichen außenpolitischen Anstrengung bewältigt hatte und damit einen Atomkrieg wieder unwahrscheinlich werden ließ, scheinen überdeutlich. Kennedy fiel 1963 einem Attentat zum Opfer – „Seven Days in May“ ist vielleicht einer von unzähligen Beiträgen zu den Verschwörungstheorien über den oder die Mörder.
Was tun, wenn’s blitzt?
Der Brite Peter Watkins wirft ebenfalls 1964 in seiner TV-Dokumentation „The War Game“ die Frage auf, was denn geschähe, wenn es zum Atomkrieg kommt. Der Film ist ein Gegengewicht zu den ab den 1950er Jahren vom US-Verteidigungsministerium erstellten Werbe- und Kurzfilmen, die die Bevölkerung beruhigen und die Folgen des nuklearen Holocaust verharmlosen sollen: „Duck and Cover“ – sich ducken und bedecken lautete der populäre wie zynische Rat an die Menschen, sobald sie den Blitz sehen. (Zusammengefasst finden sich diese an Propaganda grenzenden Filme im 1982 entstandenen Kompilationsfilm „Atomic Café“.) Wie zynisch dieser Rat war, hat der 1986 erschienene Zeichentrickfilm „When the Wind blows“ von Jimmy Murakami verdeutlicht: Dort versteckt sich ein altes Ehepaar auf anraten der britischen Regierung hinter einer an die Wand gelehnten Tür vor den Strahlen der Atombombe und geht langsam zugrunde. Die Hoffnung auf ein Überleben der Menschheit im Angesicht des Dritten Weltkrieges aufgegeben haben etliche Filme dieser Zeit, die nach alternativen Überlebensorten und –zeiten suchen. 1960 entwirft George Pal mit „The Time Machine“ die vielleicht erste Alternative: einfach in die Zeit nach dem Atomkrieg flüchten, wenn alle Strahlung verflogen ist und die Welt sich wieder erholt hat. Was sein Protagonist im Jahre 802.701 nach Christus (bis dahin wäre das Uran der Atombomben allerdings noch nicht einmal zu einem Bruchteil abgebaut) erlebt, macht jedoch auch nicht gerade Hoffnung: unterirdische Kannibalen halten sich emotions- und willenlose Menschen als Schlachtvieh.
In den 1970er Jahren etabliert sich im Blick auf die postatomare Welt, der genau diese Frage wieder aufgreift: Was wird aus der menschlichen Gesellschaft „danach“? L. Q. Jones gibt in „A Boy and his Dog“ 1974 eine Antwort darauf, die für ein ganzes Subgenre des Science-Fiction-Films paradigmatisch geworden ist. In seinem Film bevölkern Barbaren die postatomare Welt, während sich im Untergrund eine christofaschistische Kultur entwickelt hat. Jones lässt seinen Protagonisten (gespielt vom „Jungen“ Don Johnson) zwischen beiden Sphären wechseln und erkennen, dass keine lebenswert ist. Vor allem aus „A Boy and his Dog“ abgeleitete „Endzeitfilme“ wie „Mad Max 2“ (1982) oder „Hardware“ (1990) verlassen das Thema des Atomkriegs mehr und mehr und entwickeln auf dem Boden des nuklearen Holocaust utopische Action-Szenarien mit ganz eigenem Charakter. 1977 schien zumindest hierzulande eine solche Darstellung noch unschicklich zu sein: Die verstrahlten Mutanten aus Wes Cravens „The Hills have Eyes“, die sich auf einem Atomtestgelände zu kannibalischen Menschenjägern entwickelt haben, wurden in der deutschen Fassung „Hügel der blutigen Augen“ kurzerhand zu Aliens umdefiniert und der Film mit einer Neusynchronisation versehen, die bis heute als ein der dreistesten Entstellungen der Filmgeschichte gilt.
Der heiße kalte Krieg
Abermals wird durch eine amerikanische Präsidentschaftswahl eine Wende in das Thema Atomkrieg im Film eingeführt, als im Produktionsjahr von „The Hills have Eyes“ der Demokrat und Friedensnobelpreisträger Jimmy Carter das Regierungszepter an den Republikaner und Westernhelden Ronald Reagan abgibt. Reagans Außenpolitik steht auf deutlichem Konfrontationskurs zu den Sowjets. Er ließ neue Kernwaffen vor allem in Europa stationieren und eine weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem entwickeln. Der Kalte Krieg wurde wieder heiß und die Filme der 1980er Jahre daher zu den deutlichsten und bedrückendsten ihrer Art. Vor allem Nicholas Meyers 1983 erschienene TV-Produktion „The Day After“, die noch heute Inbegriff des Antiatomkrieg-Films ist, versuchte die Katastrophe mit unzweideutigen Bildern zu zeichnen: Gezeigt werden verschiedene Menschen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, die die Eskalation bis hin zu den Raketenabschüssen miterleben und danach am Chaos, der Verzweiflung vor allem aber den Strahlen langsam zugrunde gehen. Noch eindrücklicher zeichnet den Untergang der im selben Jahr erschienene „Testament“ von Lynne Littman, die das Leben und Sterben einer Kleinfamilie in einem weit ab vom Epizentrum einer Atomexplosion gelegenen Stadt betrachtet. Der Segen, im Atomblitz zu verglühen und das Leid danach nicht mehr miterleben zu müssen, wird in diesem Film überdeutlich. Eine Mutter, die nach und nach ihre Kinder sterben sieht und zu Grabe trägt, in einer Gemeinschaft, die von Verzweiflung und Angst geplagt ist – das ist das intimste Gesicht des Atomkriegs, das Film bis heute gezeichnet hat.
Doch nicht nur die Amerikaner haben sich mit dem Schrecken auseinander gesetzt. In Frankreich entsteht unter der Regie Christian de Chalonges 1981 „Malevil“, der von Überleben einer kleinen Gruppe in einem französischen Provinz-Dörfchen erzählt. Schweigen, Asche und Rauch dominieren den Film. Die Protagonisten richten sich nach dem Schlag nur mühsam wieder auf, nur um sich gleich im nächsten Konflikt – dieses mal mit anderen Überlebenden um die letzten Ressourcen – wieder zu finden. Stefan Aust, Axel Engstfeld, Alexander Kluge und Volker Schlöndorff richten in ihrem Episodenfilm „Krieg und Frieden“ 1982 den Blick aus vier unterschiedlichen Perspektiven auf den atomaren Holocaust: eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentarismus, satirisch und aufklärerisch ist die Reaktion der vier Regisseure auf die Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen in Deutschland. In der UdSSR entsteht 1986 mit Konstantin Lopushanskys „Briefe eines Toten“ ein dem Rüstungswahn entgegen gerichteter, deprimierender „Nachkriegsfilm“, der das Sterben eines altem Professors im Bunker eines Museums dokumentiert. Er schreibt seinem verschollenen Sohn Briefe, in denen er Fragen nach dem Überleben der Menschheit aufwirft – aber weder auf die Briefe noch auf die Fragen gibt es eine Antwort.
Mit der Auflösung der großen politischen Systeme zu Beginn der 1990er Jahre scheint das Thema Atomkrieg nicht mehr interessant zu sein, könnte man meinen. Dem ist jedoch nicht so. Auch in jüngerer Zeit entstehen noch Filme, die sich mit dem „Was wäre wenn?“ beschäftigen, nun jedoch oft als extrem utopisches Gedankenspiel, wie in Elio Quirogas „The Cold Hour“ (2006) , der vom Überlebenskampf der letzten Menschen auf dem Mond im Angesicht einer brennenden Erde berichtet. Oder Filme wie „Right at your Door“ von Chris Gorak, der im selben Jahr die Vision eines Atomangriffs mit einer „schmutzigen Bombe“ auf Los Angeles entwirft. Auch in Goraks Film wird die große Katastrophe wieder durch das „kleine Drama“ anschaulich gemacht, wenn ein Ehemann sich in seinem Haus versiegelt, um die tödlich gewordene Luft draußen zu halten, während seine Frau vor seiner Tür und vor seinen Augen zu Grunde gehen muss. Die Atombombe hat vielleicht ihren konkreten Schrecken verloren – als Platzhalter für kulturelle Ängste und Metapher für abstrakte wie konkrete Bedrohungen wird sie dem Film jedoch erhalten bleiben. Die Allgegenwärtigkeit und Unsichtbarkeit ihres Drohpotenzials ist beispielhaft. Sie erinnert uns an unsere gefährliche Vergangenheit und unsere ungewisse Zukunft.
zuerst erschienen in: epd Film, 8/2008, S. 14f.