Villiers de l’Isle-Adam
„Die Eva der Zukunft“
(Dt. von Annette Kolb, Nachwort: Peter Gendolla)
Reihe: Phantastische Bibliothek Band 108/st 947
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984
271 Seiten (Taschenbuch)
Keine leichte Lektüre, schon der gestelzten Sprache wegen ist „Die Eva der Zukunft“, zuerst 1886 in Paris erschienen, dann 1909 ins Deutsche übersetzt. Der Roman erzählt die Geschichte einer technischen Konstruktion – den Bau einer Androidin, die dem liebeskranken englischen Lord Ewald die Geliebte ersetzen soll. Denn er ist unheilbar in eine Frau verliebt, deren Äußeres ihn durch ihre Ähnlichkeit mit der „Venus“ von Milo in den Bann zieht, deren Inneres ihn jedoch abstößt: pragmatisch, ohne tiefe Emotionen und zärtliche Gedanken, allein dem common sense nachhängend – zudem eine Künstlerin, die in ihrer Kunst nichts als Broterwerb sieht, obwohl sie sie doch so genialisch beherrscht. Das kann für einen Romantiker wie den Lord keine Frau sein, weil er von ihr jedoch nicht loskommt, will er sich selbst erschießen.
Davon ab hält ihn niemand geringeres als Thomas A. Edison, der New Yorker Erfinder der Glühlampe und des Grammophons. Er ist ein alter Freund des Lords, dem er viel verdankt. Deshalb macht er ihm das Angebot, die Geliebte exakt als Androidin nachzubilden und mit eben jenem Geist zu versehen, nach dem sich der Lord so sehr sehnt. Der Roman stellt die über einige Wochen laufenden Gespräche zwischen Ewald und Edison dar, in welchem letzerer die mechanischen Geheimnisse der Maschine und die metaphysischen sowie überaus physischen der Frau(en) darlegt. Nachdem Ewald, der nichts mehr zu verlieren hat, einwilligt, sich die Androidin bauen zu lassen, wird seine Geliebte einbestellt, um heimlich bei ihr „Maß zu nehmen“. Schließlich ist nach einigen Wochen die Androidin fertig, Ewald zögert zunächst, nimmt sie dann aber an, nachdem er sie selbst mit dem Original verwechselt. Auf der Schiffsreise von New York in seine englische Lordschaft kommt es zu einem Unfall: Das Schiff sinkt mitsamt der Androidin – Ewald kann sich retten.
Wenn Stanislaw Lem auf dem Buchdeckel des Taschenbuchs mit der Sentenz zitiert wird, es handele sich um „eine Verspottung, gerichtet an die Adresse des weiblichen Geistes“, dann ist das noch eine Untertreibung. Was der Autor hier über die Worte seines Edison an Misogynie ausschüttet, sucht seines gleichen: Nicht nur wird die Geliebte des Barons schon beinahe als lebensunwürdiges Geschöpf dargestellt, nur weil sie „keine Tiefe“ besitzt. Auch diejenigen Frauen, die nicht zu den treuen, hausmütterlichen Gefährtinnen der durch sie gestärkten Männer gehören, werden in Bausch und Bogen als eine Art Hexen apostrophiert, die einzig und allein die Männer ins Verderben reißen wollen und deshalb ohne jede Diskussion den Tod verdienen. In mehreren zentralen Kapiteln führt Edison Ewald vor, mit welchen kosmetischen Tricks solche Frauen, deren innerliche Hässlichkeit „natürlich“ auch äußerlich zu sehen wäre, diese zu verbergen wissen um ihr tödliches Werk zu beginnen.
In der Androide mit dem Namen Hadaly, die sozusagen die zwar beseelte aber oberflächenlose Verkörperung einer Frau ist, welche erst noch mit dem Äußeren der Geliebten Ewalds überzogen werden muss, sind solche dunklen, zerstörerischen Triebe natürlich nicht vertreten. Sie ist der reine und vor allem der tiefe Geist des Weiblichen, ausgestattet mit einem „Regulator der inneren Regungen, oder besser gesagt, [..] ‚Seele'“ (S. 159) – und nicht zuletzt deshalb wird sie zum Angst-Objekt des Lords. Je mehr Edison ihm ihre mechanische Funktionsweise offenbart, desto tiefer klafft diese Angst auf als Produkt des fantastischen Leib-Mechanik-Seele-Trialismus, den er an Hadaly erlebt. Der Roman ist neben seinem misogynen Abgesang in den schier endlosen Kapiteln der technischen Beschreibung der Androidin vor allem eines: Ein Hosianna auf die Technik.
Der Techniker, Thomas Edison, wird in einer Vorrede des Autors erst einmal vom „zufällig“ gleichnamigen historischen Edison unterschieden. Es muss wohl wenigstens Rückfragen gegeben haben und eigentlich ist es auch nicht ganz verständlich, warum er diesen Namen für seine Figur gewählt hat. Der Edison des Romans ist ebenfalls der Erfinder von Glühlampe und Grammophon – hier haben seine Erfindungen jedoch den Anschein des Zaubers. Und wohl auch deshalb wird er von Edison oft „Zauberer“ genannt. Dennoch steht Edison hier auch nicht außerhalb der Gesellschaft. Insbesondere zur „technischen Öffentlichkeit“ (repräsentiert etwa durch die Gas-Konzerne, die in seinen Ideen der Elektrifizierung einen Angriff auf ihr Licht-Monopol sehen) und zu anderen Erfindern äußert er sich.
So diskutiert er mit Edison etwa die Geschichte der Robotik als eine Geschichte von Fehlschlägen und kritisiert insbesondere, dass die Erfinder es nie geschafft haben, ein menschliches Gesicht zu konstruieren, dass nicht wie eine „beleidigende Karikatur“ auf den Betrachter gewirkt hätte (S. 76f). Das Problem der „uncanny valley“ ist also schon in der Roboter-Literatur des späten 19. Jahrhunderts ein Thema gewesen. Und eine Seite später geht er dann auf die Frage ein, welche „Folgen“ seine neu erfundene Roboter-Technik auf die Gesellschaft(en) haben würde, weil er dieses „valley“ ja überwunden hat. Dieser Vorgriff auf das Problem der „Technikfolgen-Antizipation“, das die Technikgeschichte und -soziologie des späten 20. Jahrhunderts bestimmen wird, mag noch naheliegend sein. Die Tatsache, dass Edison mit seiner „elektromenschlichen Kreatur“ (S. 121 u. S. 153) Hadaly zwei Mal ein Art „Turing-Test“ (S. 120 u. S. 226-233) durchführt, um Ewald von ihrer menschlichen Qualität zu überzeugen (bzw. über ihre robotische Qualität zu verunsichern), verblüfft dann aber doch.
Fraglos – und auch das ließe sich in die Verwendung des Namens Edison als Romanfigur hinein lesen – kreuzen sich in „Die Eva der Zukunft“ fantastisch-literarische und technisch-utopische Diskurse und die Tatsache, dass vieles von dem heute wahr ist, was vor 120 Jahren in „Die Eva der Zukunft“ eine Horrorfiktion war, bestätigt mich einmal mehr in der Annahme, es gibt eine kontinuierliche Interdependenz von Science Fiction und Technikentwicklung. Der Erzähler reflektiert diese sogar:
„Trotz der bestimmten Versicherungen Edisons war es ihm [Ewald, S.H.] nicht möglich gewesen, anzunehmen, daß dieses Wesen, das ihm so gänzlich den Eindruck einer Lebenden machte, nur eine durch Geduld, Genie und Wissenschaft erzielte Fiktion sein. Und er stand vor einem Wunderwerk, dessen offenbare Möglichkeiten alle Phantasie weit übertrafen, ihn blendeten und zugleich ihm den Beweis lieferten, wie weit derjenige zu gehen vermag, der es wagt zu wollen.“ (155)
Als Roman, das habe ich eingangs schon geschrieben, ist „Die Eva der Zukunft“ heute (?) nur schwer zu goutieren: Zu stark auf die technische Konstruktion und die Misogynie konzentriert, liefert er allenfalls eine blasse, euphemistisch-positive Wiederholung von E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“, dessen düsterer Coppola/Coppelius hier sozusagen seine positive Umkehr in Edison findet. Fast möchte man meinen, die Glühlampen hätten die „Aufklärung“ zurück in die romantischen Visionen von Hoffmann getragen. Zum Ende hin verliert sich dieser Eindruck, wenn die ohnehin schon recht magisch anmutenden Erklärungen für den Körper und den Geist Hadalys noch durch den damals häufig diskutierten „tierischen Magnetismus“ (Mesmerismus) ergänzt werden und schließlich in totalen Obskurantismus mit homöopathischen Einschlägen abdriften. Aber gut, es ist ja Science Fiction – nur seinen eigenen Paradigmen (das eben alles technisch erklärbar sei) sollte sie dennoch nicht widersprechen.
Literarisch recht ärgerlich ist der angepappte Schluss, weil man an seiner Kürze merkt, dass der Autor ihn der moralischen Konventionen wegen „nur angehängt“ hat: Auf den beiden letzten Seiten erfahren wir, dass natürlich nicht sein konnte, was nicht sein durfte: Die in einer sargähnlichen Kiste verstauten Androidin kommt bei einer Schiffskatastrophe um und Ewald versucht sie zu retten, wird aber abgehalten. Dass sich Villier de l’Isle-Adam hier großzügig bei Edgar Allen Poes „Die längliche Kiste“ (1844) bedient hat, steht wohl außer Frage.
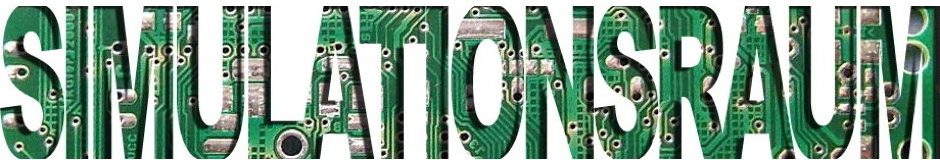





Manfred Schneider, „Traumfrau aus Technik und Philosophie“: http://www.nzz.ch/2007/05/07/fe/articleF1D8X.html
Danke! Ob das der Manfred Schneider aus Bochum ist?
Seine Lektüre fällt etwas wohlwollender als meine aus – ich habe bewusst auf jene „Altersmilde“ verzichtet, die man so alten Texten sonst gern angedeihen lässt, immer den jetzigen Leser im Blick. 😀
Dieser tolle Größenwahn, dass der Buch-Edison sich grämt, weil er seine Erfindungen nicht schon früher gemacht haben konnte, um so die biblischen Mythen zu konservieren, war mir ganz entfallen. Ja, wunderbar!
Derselbe! Wie könnt Ihr glauben, ich hätte Euch mit einem geringeren belästigt?
*
Ein Mann in der Blüte seiner Jahre – es steht ihm nur zu gut an, der Altersmilde abhold zu sein. Doch werfe er sich nicht zu arg dem Zeitgeist an die Brust (erscheine diese noch so zart, so muss sie nicht wahrhaftig sein)!
*
Über all dem möchte ich es nicht versäumen, nun deutlich noch meine Freude zum Ausdruck zu bringen über diesen – nebst anderen – schönen neuen Text(en) an diesem Ort. Habt Dank.